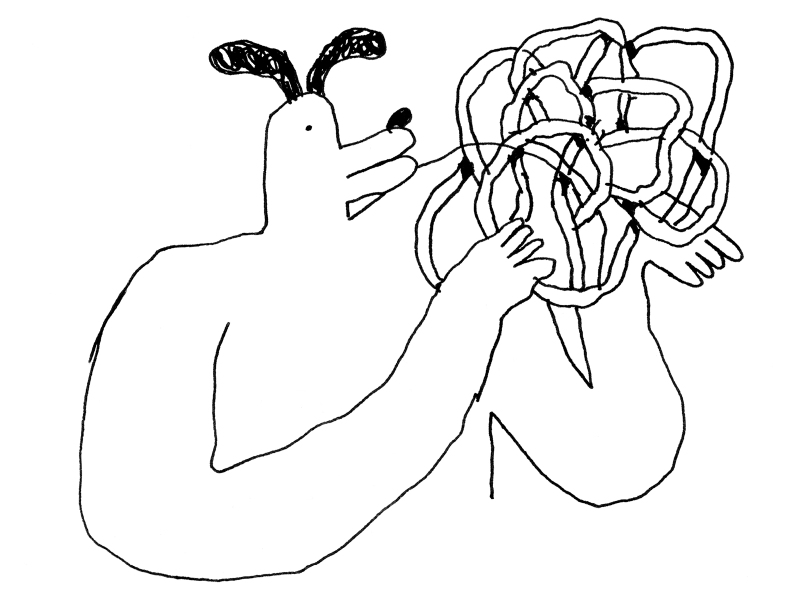Wolfgang Ellenrieder – Perspektivwechsel: Wahrnehmung als Vollendung
Je mehr sich die Kunst der eigenen Gegenwart, dem eigenen Zeitalter annähert, desto schwerer gelingt es den Betrachter*innen oftmals mit ihr in Resonanz zu treten. Dies wirkt erst einmal paradox, ist man doch der Jetztzeit vermeintlich am nächsten. Neben dem Publikum ist es auch die Kunstgeschichte selbst die aufgrund ihres historisierenden Charakters in Erklärungsnot gerät. Eine weitgehende Subjektivierung der Bildsujets und künstlerischen Ideenwelten, die mit dem ‚fin de siècle‘ einsetzte und spätestens seit den 1950er-Jahren zu einem festen Bestandteil der Gegenwartskunst wurde, tut ihr Übriges.
Auch wenn sich dieser Befund den Vorwurf einer verkürzten Darstellung gefallen lassen muss, so ist er dem zeitgenössischen Publikum wohl nicht gänzlich fremd. Freilich fungierte Kunst sowohl um die Jahrtausendwende ebenso wie heute weiterhin als Motor für gesellschaftlichen Wandel. Ob als Impulsgeber für Forschung und Wissenschaft, oder als Katalysator für reflexive, politische Praktiken – künstlerische Erzeugnisse können nicht zuletzt ein neues, kollektives Lebensgefühl illustrieren, ein veränderndes Kunstverständnis offenbaren, oder schlicht als Zeitdokumente agieren.
„Hochsitz“ (2013) des 1959 in München geborenen Künstlers Wolfgang Ellenrieder bewegt sich mustergültig zwischen den hier umrissenen Wechselwirkungen. In hellen Grautönen setzt sich die dargestellte Jagdkanzel von dem grau-schwarz schattierten Hintergrund ab. Auch die zwei dunklen, schwarzen Fensteröffnungen geben keinen Blick in das Innere der vermeintlich menschenleeren Holzkonstruktion frei. Die Umkehr der Rollen zwischen Beobachter*in und beobachtetem Subjekt intensiviert den unheimlichen Gesamteindruck der dargestellten Szene.
Entgegen der anfangs skizzierten These einer gewissen Beliebigkeit der bildenden Künste, ließen sich natürlich auch bei Ellenrieder etliche, bewusst gesetzte kunsthistorische und stilgeschichtliche Querverbindungen ziehen. Für das vorliegende Werk erscheint jedoch besonders eine Engführung zweier werksinterner Stränge im Œuvre des Künstlers lohnend. Kunstgeschichte im Kleinformat.
Wie in den 2005 entstandenen ‚Zeltbildern‘ herrscht auch in „Hochsitz“ eine seltsame Losgelöstheit von Zeit und Ort. Anonym stehen die ‚Behausungen auf Zeit‘ in einer diffusen und ortslosen Umgebung. Als für die Arbeiten Ellenrieders charakteristisch erweist sich ein Abbildungsrepertoire, welches sich unter anderem aus dem Fundus digitaler Bilderwelten speist. Neben den für die Werksreihe verwendeten, im Internet gesammelten Privataufnahmen, greift der Künstler auch auf sogenannte Stockfotos zurück: auf jene Bilder, die in Printmedien, Werbung und Blogs als illustratives Beiwerk fungieren. Sie offenbaren eine werksinhärente Parallele zu Ellenrieders halbmobilen Behausungen. So bewegen sich die Motive der Stockfotografie mit voller Absicht an der Grenze zwischen Beliebigkeit und Eindeutigkeit. Auf der einen Seite soll eine möglichst breite Passgenauigkeit gewährleisten werden, auf der anderen Seite steht ein bewusst mehrdeutiger Symbolcharakter im Fokus. Ellenrieder greift in „Hochsitz“ den prominenten Vorwurf der Beliebigkeit auf, transformiert ihn jedoch, indem er ihn in ein Beziehungsgeflecht aus Wirklichkeit, Abbild und Symbol verwebt. Im Falle der surreal anmutenden Zelte bedeutet dies trotz der vorgeblichen Kontextlosigkeit etwa eine Assoziationskette von Unterkunft, Geborgenheit und Idylle. Darüber hinaus offenbart sich aber auch die Diskrepanz zwischen der aus dem Entstehungskontext der fotografischen Vorlagen resultierenden Intimität und der durch die Veröffentlichung im Internet erzeugten maximalen Öffentlichkeit.
Was also löst der „Hochsitz“ aus? Hier demonstriert das Werk seine besondere Stärke: So gewinnt es gerade dadurch an Aktualität, dass es die Ausdeutung und Bedeutung fast vollständig auslagert und an die Deutung der Betrachter*innen abprallen lässt. Das Motiv des Hochsitzes und die sich nun in doppelter Hinsicht ergebende Umkehr der Beobachter*innenperspektive greift damit die individualistischen Binnenlogiken unserer bilddurchfluteten Gegenwart auf und verdichtet die Radierung und ihre Rezeptionsbedingungen zu einer pointierten Reflexion des geltenden Ist-Zustands zeitgenössischer Wahrnehmungsmechanismen.
TEXT: Adrian Kunder, 2025.